
Interview mit Saskia Steinheimer
Saskia Steinheimer ist Leitende Ärztin Neurologie am Spitalzentrum Biel und Mutter von zwei Kindern.
21.08.2023
Du bist Fachärztin Neurologie – wann hast du dich für dieses Fach entschieden?
Während des Studiums ist man ja noch sehr offen und nimmt alles auf wie ein Schwamm. Ich fand verschiedenen Fachrichtungen interessant. Dann ist mir klar geworden, dass ich mich besonders fürs Gehirn interessiere, es ist für mich das spannendste menschliche Organ. Die Neurologie-Vorlesungen haben mich sehr geprägt. Der Chefarzt war ein begnadeter Rhetoriker. Er hat immer eine Patientin oder einen Patienten in die Vorlesung mitgebracht oder hat uns spontan mit auf die Station genommen. Wir konnten jedes Mal an einem konkreten Fall arbeiten und die Anamnese erstellen. Das praxisorientierte Arbeiten und Lernen hat mir sehr entsprochen, da ich nicht gerne nur übers Hören Wissen aufnehme. Ich hatte keine Hemmungen, habe immer mitgemacht, war vorne dabei. Eine Diagnose zu stellen ist fast wie Detektivarbeit, man muss immer um die Ecke denken. Parallel zu den Vorlesungen hatten wir Untersuchungskurse auf den Bettenstationen – die waren auch super. Die Neurolog:innen waren mir sehr sympathisch. Und dann war es klar für mich.
Dein Lebenslauf verlief nicht so geradlinig – wie kam es dazu?
Schon als ich das Erasmus-Tertial in Lausanne gemacht habe, wusste ich, dass ich gerne in die Neurologie möchte und auch in der Schweiz arbeiten möchte. Es hat mich sehr beeindruckt, wie in der CH gearbeitet wird. Hier ist die Teaching-Kultur ganz anders, man nimmt sich viel mehr Zeit für Erklärungen. In Deutschland waren alle ständig im Stress. In Lausanne hatte man Spass an seiner Arbeit und hat das Leben genossen.
Während meines Studiums in Berlin hiess es, dass man als Mediziner:in aus seinem Quartier nicht mehr rauskommt. Das wollte ich nicht und habe mich darum gleich nach dem Studium in der Schweiz beworben. Aber frisch von der Uni bekam ich noch keine Stelle in der Neurologie. Voraussetzung war mindestens ein Jahr in der inneren Medizin oder einem ähnlichen Fachbereich. Also habe ich in der Psychiatrie im Kantonsspital Fribourg angefangen, dieses Fremdjahr lässt sich sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz auf den Facharzt anrechnen.
Dort habe ich in einem eher internationalen Team gearbeitet, wurde schnell integriert und habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt. Dann entschied ich mich, in die innere Medizin zu wechseln und bekam eine Anstellung im Wallis, in St. Maurice und Martigny. Schon einen Monat nach dem Beginn in der Inneren kam eine Anfrage aus Bern für die Neurologie.
Also bin ich im April 2009 nach Bern gezogen und habe in der Neurologie im Inselspital meinen Facharzt abgeschlossen. Im ersten Jahr als Assistenzärztin habe ich meinen Mann kennengelernt und am Ende des ersten Jahres war ich schwanger. Alles hat sich irgendwie ergeben.
Dazu kam Folgendes: Als ich angefangen habe, gab es noch kein Logbuch, in dem die Weiterbildungsdauer bzw. -jahre digital erfasst wurden. Es gab nur Zeugnisse in Papierform. Mit der gesamten Neuorientierung und Umstellung mit den Kindern ging vieles unter und ich habe wichtige Unterlagen nicht umgeschrieben und aktuell gehalten. Als ich dann 2017 alles eintragen wollte, wurde mir bewusst, dass die Innere Medizin nicht mehr gültig war, weil sich die Weiterbildungsverordnung geändert hatte. Ich war also 37, hatte keinen Facharzt und musste wieder als Assistenzärztin arbeiten. Ein halbes Jahr habe ich das komplett ignoriert und einfach weitergemacht. Als ich stellvertretende Oberärztin wurde, stimmte das einfach nicht – ich war mehr als bereit, Oberärztin zu werden. Daher habe ich dann alle Unterlagen eingereicht und Rekurs gemacht – mit der Hoffnung, dass die Zeit in der Inneren doch anerkannt werden würde. Es dauerte über ein Jahr, bis der Rekurs durch war – mein Antrag wurde abgelehnt, weil die Kriterien nicht erfüllt waren.
Also musste ich sechs Monate Innere Medizin nachholen, immerhin nur 6 Monate. Das war ein riesiger Rückschlag. Im Pandemie-Jahr 2020 habe ich dann diese Zeit als Assistenzärztin absolviert. Ich war vierzig, hatte zwei Kinder, musste 100 Prozent arbeiten und 7 Nachtdienste bewerkstelligen. Eine grosse Herausforderung!
Wie lief der Wiedereinstieg nach der Mutterschaftszeit?
An dem Tag, als mein Chef mir sagte, dass ich ins ENMG wechseln sollte, musste ich ihm mitteilen, dass ich schwanger war. Das war schwierig. Der leitender Arzt, der für die Planung verantwortlich war, war mit der Situation überfordert. Im ENMG war es aber möglich, 50 Stellenprozent zu arbeiten – dadurch gab es einen Paradigmenwechsel. Soweit ich weiss, war ich die erste Assistenzärztin am Spital, die schwanger wurde, im Teilzeitpensum zurückkam und den Facharzt machen konnte. Welch grosses Glück! Die jüngere Generation hat hier neue Wege ermöglicht, sie stand dafür, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
So ging dann alles auf. Ich arbeitete zu Beginn 50, dann 60 Prozent während der restlichen Ausbildungszeit. Nach dem ENMG wollte ich noch ins EEG wechseln. Zwischendurch wurde ich wieder schwanger und musste dann nach der Mutterschaftszeit ein Jahr überbrücken, bis dort ein Platz mit Jobsharing frei wurde.
In welchem Bereich hast du deine Doktorarbeit geschrieben?
Für die Doktorarbeit habe ich zwei Anläufe gebraucht. Ich bin die erste Akademikerin bei uns in der Familie, meine Eltern konnten mir also nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es wäre sicherlich schlauer gewesen, wenn ich nach dem Staatsexamen gejobbt und die Doktorarbeit fertig geschrieben hätte. Aber meine Eltern waren der Meinung, dass ich zuerst meine Ausbildung abschliessen und dann gleich arbeiten sollte. Ich war deshalb nicht mehr in Berlin und hatte keine Unterstützung mehr. Parallel zum Arbeiten eine Doktorarbeit zu schreiben war einfach zu viel und für mich nicht möglich, daher habe ich dann später mit der Doktorarbeit nochmals von vorne angefangen.
In der Neuroimmunologie durfte ich dann 2014, also nach dem zweiten Kind, bei einer klinischen Forschungsarbeit zu einer Pharmastudie mitarbeiten. Dieses spannende Projekt wurde dann meine Doktorarbeit.
Wie geht es dir mit der maximalen Soll-Arbeitszeit? Kannst du sie einhalten?
Nein! Von Beginn meiner Tätigkeit in Biel an habe ich viele Überstunden geleistet, da ich dort von Anfang an Leitungsfunktionen übernommen habe. Als Oberärztin im Inselspital war die Arbeitsbelastung je nach Spezialgebiet und Organisation sehr unterschiedlich. Im Notfall- und Konsiliardienst habe ich viele Überstunden gemacht, dagegen war es auf der Reha schon fast "langweilig". Dort habe ich mich am Ende um die Organisation der Gutachten gekümmert sowie einen Grossteil der Supervision übernommen. Hier kam mir meine Zusatzausbildung als Gutachterin zugute. Leider ist auch aktuell der Stress viel zu gross, das ist für die Gesundheit nicht gut.
Wie bringt ihr als Familie alles unter einen Hut?
Es war und ist eine Herausforderung, die Arbeit in der Klinik, die Forschung, die Facharztprüfung und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Ein Leben mit Kindern und zwei berufstätigen Eltern ist halt anstrengend. Ich hatte immer das Gefühl, aufgrund der Teilzeitarbeit wäre ich vielleicht weniger gut ausgebildet als die anderen – habe aber als Oberärztin verstanden, dass das gar nicht der Fall ist. Da ich länger an verschiedenen Orten gearbeitet habe, hatte ich mehr Zeit, mir das nötige Wissen anzueignen. Als ich Oberärztin wurde, war ich schon älter, hatte mehr persönliche Reife und die Erfahrung als Mutter.
Immer wieder habe ich mir Gedanken gemacht, dass es schön wäre, wenn ein Elternteil zuhause für die Familie da wäre und der andere arbeiten geht. Die mentale Last einer Familie ist nicht zu unterschätzen. Man muss an so vieles denken – Geschenke, Gespänli, Schule, Fortbildung und Kinderbetreuung organisieren und so weiter...
Unser Sohn ging zwei Tage pro Woche in die Kita des Inselspitals. Zur ersten Klasse ist er ins normale Schulsystem eingetreten, danach ging er in die Tagesschule. Meine Tochter hatte ich im öffentlichen Kindergarten und dann in der Tagesschule. Schulferien müssen immer für beide überbrückt werden.
Mein Mann arbeitet 80 Prozent als Neuropsychologe, er hat geregeltere Arbeitszeiten und muss nur an zwei Feiertagen pro Jahr arbeiten.
Pro Woche bin ich an zwei Tagen zu Hause. Mein Mann ist einen Tag zuhause und kümmert sich um alles, was dann anfällt – er ist eine grosse Hilfe und Unterstützung. Wenn ich dann zuhause bin, übernehme ich alles, so dass er seine Zeit hat.
Trotz Höhen und Tiefen habe ich es geschafft, mit 43 Fachärztin zu werden, eine Doktorarbeit zu schreiben, eine Kaderposition zu bekommen und ein glückliches Familienleben zu führen.

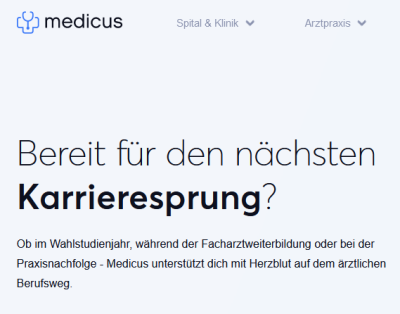

Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion