
Interview Lydia Maderthaner
Lydia Maderthaner ist 32-jährig und in einer festen Beziehung. In ihrem letzten Jahr als Assistenzärztin arbeitet sie 60 Prozent klinisch (UPD) und 30 Prozent in der klinischen Forschung (Uni Bern). Lydia strebt den Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie an.
20.06.2022
Kannst du kurz etwas über dich erzählen?
Ich heisse Lydia Maderthaner, bin 32 Jahre alt, lebe in einer festen Beziehung und geniesse das Dasein als DINK (Double Income, No Kids). Ich komme aus Wien und habe dort studiert, das praktische Jahr habe ich aber fast ausschliesslich in der Schweiz verbracht. 2016 habe ich das Studium abgeschlossen. Im Regionalspital Riggisberg hatte ich nach 6 spannenden Monaten im PJ dort anschliessend auch gleich meine erste Assistenzarztstelle angenommen. 2017 wechselte ich an die Universitätsklinik für Neurologie und seit mehr als 4 Jahren arbeite ich an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Bern. Jetzt bin ich im letzten Assistenzarztjahr zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Das kleine Landspital war im Praktikumsjahr eine wunderbare Vorbereitung auf den «klassischen Arztberuf» mit einem interdisziplinären Notfall und allgemeinmedizinischer Station. In diesem familiären Umfeld fand ich viel Rückhalt meiner Vorgesetzten und Kollegen und hatte schon als Unterassistentin viel Verantwortung übertragen bekommen. Damit bin ich rasch in meine neue Rolle als Ärztin gekommen und habe eine sehr vielfältige, komplexe und ganzheitliche Sicht auf den Arztberuf gelernt. Ich liebte die innere Medizin und die Arbeit als Notfallärztin und konnte mir den Facharzt für Innere Medizin gut vorstellen. Ich kann nur empfehlen, in einem kleinen Spital anzufangen, wenn man bereit ist, schnell viel Verantwortung zu tragen. Mein Fazit: Es war ein harter Start im Landspital, aber ich habe dort ein freundschaftliches, familiäres Arbeitsklima und eine tolle Grundausbildung bekommen. Man sollte auch folgendes bedenken: bis man sich sicherer und wohler fühlt mit der neuen Rolle und Verantwortung, ist es nirgends leicht. Ich denke, vom Studium in den Arztberuf zu wachsen, ist unabhängig von der Stelle und trotz aller theoretischen Vorbereitung im Studium, immer sehr anstrengend und mit Selbstzweifeln verbunden.
Welches war deine nächste berufliche Station?
Anschliessend an die Zeit in der inneren Medizin, musste ich einfach in die Neurologie, da mich das Gehirn von allen Organen immer schon am meisten faszinierte. Fast ein Jahr war ich an der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital Bern. Dort habe ich unter anderem dieses gelernt: wie sehr man nichts gegen sein eigenes Naturell tun kann und sollte. Ich war schon immer von Grund auf neugierig und möchte alles im Detail verstehen – im Studium ist das eine gute Eigenschaft. Im Klinikalltag sind hingegen in vielen Kliniken eher Geduld und Aufopferungsbereitschaft von Vorteil. Schliesslich habe ich dort aber viel Fachliches gelernt, was ich nun in der Psychiatrie sehr gut brauchen kann. Ich lernte dort auch, dass mich psychische und «funktionelle» Aspekte besonders interessieren. Ich hatte zwei tolle Kollegen, die dort das Fremdjahr für den Facharzt in Psychiatrie machten. Das hatte mich unter anderem dazu bewegt, mich nach einem Jahr auf der Psychiatrie vorzustellen und ich wechselte an die UPD. Obwohl die Aufgaben an der Uniklinik für Psychiatrie auch nicht immer ein Spaziergang sind, hatte ich sofort wieder mehr Interesse an meinem Job als Ärztin gefunden und habe sofort gespürt, dass ich angekommen war, unter «meinen» Patienten und «meinen» Kollegen. Viele müssen da lachen, wenn ich das sage, aber ich muss sagen, unter den psychiatrischen Patienten habe ich die Schrägsten, aber auch nettesten und aufregendsten Persönlichkeiten kennengelernt. Und ausserdem stimmt auch die Work-Life-Balance hier wunderbar.
Was gefällt dir an der Medizin?
Es gefällt mir so vieles. Ich habe das Medizinstudium aus reinem Interesse begonnen. Anfangs hatte ich kein Bedürfnis, Ärztin zu werden, diese Rolle war mir noch sehr fern. Jetzt bin ich umso leidenschaftlicher. Wir dürfen unterschiedlichste Menschen kennenlernen, wir dürfen Rätsel lösen, uns wichtig und gebraucht fühlen, können Wichtiges entscheiden und lernen, mit unseren Unzulänglichkeiten umzugehen. Der menschliche Körper hat mich schon immer staunen lassen und ist für mich eine unerschöpfliche Quelle von Erkenntnis und Neugierde. Und da wir ja in der Medizin über den Menschen lernen, sind die Erkenntnisse, die ich dabei gewonnen habe, nebenbei auch immer wieder persönlich interessant und wertvoll.
Welchen Facharzttitel hattest du während des Studiums im Blick?
Ich habe mit einem besonderen Interesse für Psychiatrie begonnen und habe dann im Verlauf des Studiums – besonders während der Blockpraktika und Unterassistenz-Stellen – viele weitere interessante Fächer entdeckt. Meine Masterarbeit und das Doktorat habe ich beispielsweise in Urologie gemacht. Zunächst wollte ich Urologin werden, weil mir das Feinchirurgische gut gefallen hat.
Und dann ist es anders gekommen?
Ich bin erst über Umwege durch andere Fächer und Erfahrungen wieder zurück zur Psychiatrie gekommen. Ich denke, dass es aber genau diese Umwege ausmachen, dass ich dann tatsächlich in der Psychiatrie gelandet bin, da ich das Fach jetzt doch deutlich differenzierter sehe als damals und jetzt auch weiss, was ich beitragen möchte.
Was macht den Unterschied aus zwischen einer guten und einer schlechten Stelle?
Ganz klar: Erst einmal das Personal. Alle sagen es und es klingt schon fast wie ein Spruch aus einem Gratiskalender. Dann hört man meist auf Empfehlungen von Kollegen. Doch die sind so eine Sache – ich habe sie oft als nicht brauchbar erlebt. Erstens, da Sympathie und Passung von Menschen etwas sehr Individuelles ist. Zweitens wechselt das Personal im Gesundheitswesen meist rasch und damit auch die Stimmung in einer Institution. Man sollte also nie vergessen, dass der Erzählende, der von einer Institution berichtet, ja auch selbst dieses Klima mitgestaltet hat. Ich habe nicht selten erlebt, dass ein oder zwei Personen den grossen Unterschied des Arbeitsklimas ausmachten. Aber nicht nur die Assistenzarztkollegen, auch der Chef, Vorgesetzte und Pflegepersonal sind essentiell für eine gute Erfahrung. Nicht unerwähnt möchte ich hier Arbeitszeitregelung, Flexibilität, Einhaltung der Weiterbildungsbestimmungen, als einige von vielen wichtigen Kriterien für eine gute Stelle, nennen. Für eine gute Stelle ist also klar auch Glück nötig – auch Glück mit der Philosophie oder Führung einer Stelle, ob diese zu einem passt.
Was waren bahnbrechende Ereignisse in deiner Berufslaufbahn, was hat dich geprägt?
Am entscheidendsten waren wohl meine ersten drei Jahre mit direktem Patientenkontakt und Verantwortung (PJ und erste zwei Assistenztarztjahre). Dort wurden jegliche Interessen – ob Urologie, Innere Medizin oder Neurologie – auf die Probe gestellt: Womit möchte man sich tatsächlich täglich, auf jedem Kongress, bei jedem Patienten, befassen, worüber redet man sogar in der Mittagspause gerne mit seinen Kolleginnen und Kollegen und worüber möchte man immer mehr wissen? Eine Schlüsselerfahrung machte ich auf der Neurologie, die ich erst im Nachhinein richtig einschätzen konnte: Ich hatte keine Zeit mehr für mich, meine Hobbys und meinen Freund und ich hatte Angst, dass mein Leben nun immer so aussehen würde. Mir hat diese Erfahrung aufgezeigt, was mir wichtig ist - im Beruf und im Privaten.
Was sind besondere Herausforderungen deines Fachgebiets, was ist besonders toll daran?
Eine Herausforderung in der Psychiatrie ist sicher, dass man einen grossen Spagat von Herangehensweisen und somit auch Kompetenzen machen muss. Zwischen den rein psychotherapeutischen Methoden und psychiatrischer Notfallbehandlung liegen Welten, die ich zu verbinden liebe, doch sie bleiben ständig herausfordernd. Auch begleiten einem im Berufsalltag fast permanent Zweifel über das Wissen und die Ansichten in der Psychiatrie, da so viel im Wandel ist, und das Fach immer schon nahe an anderen Disziplinen stand. Es zwingt einem, über den Tellerrand zu blicken, auch in die Ethik, Psychologie, Philosophie oder Soziologie zum Beispiel. Mit der Weiterentwicklung der bildgebenden Verfahren und anderer moderner Untersuchungsverfahren sind zahlreiche neue Möglichkeiten zur Betrachtung psychischer Prozesse hinzugekommen. Daher werden wir in einigen Jahrzehnten wohl ganz anders über psychische Krankheiten denken. Das ist das eine. Und das andere: Im Alltag liebe ich die Patientinnen und Patienten, die mir den Horizont öffnen, mich herausfordern, die teilweise unglaublich starke Persönlichkeiten und häufig sehr dankbar sind. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Patienten über das „essentielle“ rede, hinter die Fassade sehen darf, wie es ihnen wirklich geht. Das ist ein Privileg. Psychisches Leid ist überall zu finden und belastet Menschen ungemein. Es ist schön, effektive Mittel und Methoden dagegen zu haben. Immer wieder erwähne ich gerne und muss mir auch oft selbst sagen, dass die Psychiatrie im grossen Feld der Medizin die wirksamsten Medikamente besitzt (z.B. Antipsychotika, Methylphenidat, Lithium), was selbst Mediziner:innen oft nicht wissen. Die grösste Herausforderung aber sehe ich derzeit weiterhin im sich erst langsam erholenden Ruf der Psychiatrie und die meist immer noch falschen Ansichten der Allgemeinbevölkerung und Mediziner über die Psychiatrie im 21. Jahrhundert. Leider hört man aber auch heute noch über Fachfremde - oder auch Fachkollegen- welche das Fach Psychiatrie als Deckmantel für eigene Ansichten und Therapiemethoden missbrauchen, die jeder Evidenzlage entbehren.
Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Ich bin momentan zu 60 Prozent klinisch (UPD) und 30 Prozent in der klinischen Forschung (Uni Bern), angestellt. Ich habe auch in der Forschung viel Patientenkontakt und arbeite in Klinik und Forschung auch mit apparativen psychiatrischen Verfahren, wie z.B. mit TMS (transkranielle Magnetstimulation) und EKT (Elektrokonvulsionstherapie). Ein typischer Tag wäre z.B. morgens EKT im ZAWR Inselspital mit meiner Oberärztin, dann Morgenrapport, dann Sprechstunde. Nachmittags Montags - Supervision. Mittwochs sind morgens jeweils Fallvorstellungen von Assistenzärzten angesetzt, dienstags Journalclub, einmal die Woche Meta-Analysen-Vorstellung durch einen Oberarzt. Am Donnerstagnachmittag haben wir üblicherweise externe Weiterbildungen (in Psychotherapie oder Psychiatrie Theorie).
Ich liebe diese Abwechslung sehr. Meine freien 10 Prozent nehme ich geblockt oder wie es mit der Dienstplanung aufgeht, und sind für meine Hobbies bestimmt. Unbezahlte Arbeitspausen habe ich jeweils einen Monat lang bei Stellenwechseln und vor Beginn der Assistenzarztzeit gemacht, also drei Mal insgesamt. Ich könnte mir aber auch länger Urlaub oder unbezahlte Ferien nehmen. Ausserdem habe ich mir durchgängig und bis heute intensive Hobbys erhalten können: Turniertanz (Paartanz) mit Wettkämpfen, Tennis, Klavier und andere. Das ist ein wundervoller Ausgleich.
Da wir mit unserer Arbeit ein ganzes Leben verbringen können sollten und ich das Interesse und die Neugierde nicht verlieren will, kommt für mich eine Stelle, in der ich Freund, Freunde und Hobbys vernachlässigen muss, nicht infrage. Das heisst aber nicht, dass ich nicht auch mal abends an einem Paper sitze oder Daten auswerte – das mache ich aber für mich selbst und es gibt auch Zeiten, da lasse ich alles liegen und lebe einfach ein wenig.
Wie kommst du mit der maximalen Soll-Arbeitszeit klar?
Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner, die ich kenne, fordern Teilzeitarbeit beziehungsweise eine Reduktion der 50-Stunden-Woche. Ich finde, dass es sehr auf den Umgang mit Über- oder Unterstunden durch den Arbeitgeber und auch auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ankommt. Für mich ist etwas weniger als 100 Prozent ideal. Ich kann jederzeit mehr machen oder länger bleiben, wenn ich will oder etwas besonders interessant ist, ich muss aber nicht. Ich muss auch sagen, dass ich kein Fach kenne, indem schon so sehr auf Teilzeit und flexible Arbeitszeiten und die Work-Life-Balance geachtet wird, wie in der Psychiatrie.
Wie bringst du Freizeit, Familie und Beruf unter einen Hut?
Mit Teilzeit, einem flexiblen Arbeitgeber und dem Ausgleich durch ein tolles Freundschaftsnetz, Hobbys, einer unterstützenden Beziehung und – last but not least – dem richtigen Fach. Denn man darf sich nichts vormachen: Es gibt je nach Fachrichtung immer noch grosse Unterschiede bezüglich einer guten Work-Life-Balance – vielleicht aber nicht mehr lange?
Was würdest du wieder genauso machen wie früher?
Mich trauen, für mich einzustehen und ehrlich auszusprechen, wie ich arbeiten möchte und wie nicht.
Und was würdest du anders machen?
Das Gute ist, dass man im Nachhinein ja meist meint, von allen Erfahrungen profitiert zu haben. Zumindest mir geht das so und ich würde daher nichts anders machen. Aber ich wüsste heute, dass ich mir weniger Sorgen zu machen brauchte, ob ich meinen Traumberuf finde und wie viel ich ab nun arbeiten müsse. Denn wir haben es selbst in der Hand – niemand zwingt uns, an einer Stelle/in einem Fach zu bleiben und wir können unsere Meinung auch wieder ändern.
Welche Infos haben dir gefehlt zur Planung deiner Berufslaufbahn?
Es ist immer interessant zu wissen, wie die Arbeit an einer Stelle genau aussieht, ob die Assistenzärzt:innen zu Fortbildungen gehen können, wie viele Überstunden im Schnitt gemacht werden (sofern das überhaupt festgehalten wird) und Ähnliches. Das weiss man vorher selten, insbesondere erwähnen es die Kolleg:innen vor Ort ungern, da sie schlicht froh sind, Unterstützung zu bekommen. Daher versuche ich bei Fragen von Kolleg:innen zu meiner Arbeitsstelle ehrlich zu sein. Das hält am längsten und vermeidet Enttäuschungen.
Inwiefern kannst du Vorbild sein und welche Ratschläge hast du für jüngere Kolleg:innen?
Ich empfehle, bei Unsicherheit bezüglich Stellenwahl Verschiedenes auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Dies immer mit einer – für Mediziner oft ungewöhnlich - selbstbewussten Haltung, dass man diejenige ist, die sich diese Stelle mal anschaut und nachher selbst wählt, wie man sein Leben gestalten möchte. Ich finde, wir Mediziner:innen denken oft zu sehr daran, was andere von uns erwarten und wen wir vielleicht enttäuschen könnten, und zu wenig an das, was wir selbst brauchen, um zufrieden zu sein. Ich appelliere also für mehr Loyalität sich selbst gegenüber, vor allem in den ersten Assistenzjahren.
Wo willst du beruflich in zehn Jahren stehen?
Das ist eine schwierige Frage. Mit dem Fach Psychiatrie stehen mir jegliche Türen offen: von einer akademischen Laufbahn über interdisziplinäre klinische Arbeit, Unispital, apparative und pharmakologische Behandlungen bis hin zur eigenen Praxis oder zum Schwerpunkt auf die psychotherapeutische Arbeit. Ausserdem ist es wohl in keinem anderen Fach so leicht, sich selbstständig zu machen – die Nachfrage an niedergelassenen Psychiater:innen ist derzeit am Explodieren und man braucht dafür nichts als zwei Sessel und sich selbst. Dennoch weiss ich noch nicht, wo ich landen werde, und das muss ich auch nicht wissen. Ich habe selbst erlebt, wie sehr sich innerhalb kurzer Zeit Wünsche und Bedürfnisse ändern können, sodass ich mir erlaube, weitere zehn Mal meine Meinung zu ändern. Derzeit liebe ich die Tätigkeit am Unispital und in der Forschung. Ich schliesse aber in Zukunft auch eine Mischung aus Forschung, Uniklinik und Selbstständigkeit nicht aus. Ich kenne einige psychiatrische Fachärzt:innen, die das erfolgreich und zufrieden handhaben.
Was ist dir sonst noch wichtig zu sagen?
Meine Ansicht der Work-Life-Balance hat sich ein bisschen verändert: Ich dachte früher immer, Work-Life-Balance heisse einfach, weniger zu arbeiten, fertig. Inzwischen glaube ich: Jede Stunde Arbeit, die man mit etwas verbringt, das einem nicht interessiert, ist dreimal so anstrengend wie eine Arbeit, die man gern macht. Und deswegen ist für mich eine gesunde Work-Life-Balance mittlerweile mehr. Sie bedeutet, wie viel ich mich selbst in meiner Arbeit einbringen kann, wie viel ich sie selbst gestalten kann, wie viel Dankbarkeit ich bekomme und wie sehr mich die Arbeit / der Arbeitsplatz in meiner Neugierde und Interesse an meinem Fach unterstützt. Ich denke, es ist sehr wichtig, wie wir die Work-Life-Balance in Zukunft im Berufsfeld der Medizin hinbekommen.


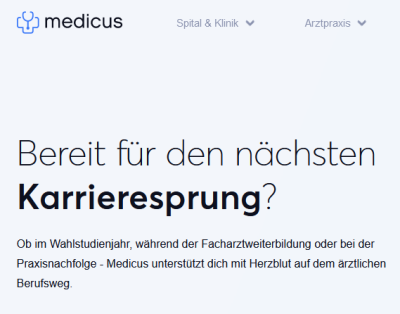
Kommentare
Noch kein Kommentar veröffentlicht.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion